Die Auswirkungen der Corona-Krise werden erst langsam sichtbar: Das Leben vieler Menschen wurde schwer erschüttert – die Verunsicherung ist groß und das Vertrauen in den Staat gering. Deutschland ist tief gespalten: Ideologische Grabenkämpfe finden in den sozialen Medien statt, Verschwörungstheorien und Politikverdrossenheit boomen. Wie konnte es dazu kommen? Was ist eigentlich passiert? Am Ende der dritten Welle ist es Zeit für eine Analyse.
Bergamo und die erste Welle
Wenn ein neues Thema in den Medien und in der Politik aufkommt, dann gibt es zunächst eine Zeit der Definition: Um was handelt es sich? Gibt es bereits Krankheiten, die ähnlich verlaufen? Sollte man es als Seuche begreifen und alle Kranken isolieren sowie Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen oder sollte man es wie eine individuelle Krankheit verstehen, die ein Eingreifen des Staates nicht erfordert? Dieses Austarieren zwischen staatlicher Verantwortung und privater Eigenverantwortung ist insbesondere dann bei Krankheiten der Fall, wenn die Übertragungswege und die Sterblichkeit noch unklar sind: Je höher die Sterblichkeit und je einfacher die Übertragung stattfindet, desto eher sieht sich der Staat in der Verantwortung. Bei Corona waren beide Punkte am Anfang ungeklärt.
Naheliegenderweise wurde aber Corona am Anfang als Grippe verstanden, da es sich um ein Virus aus einer schon bekannten Virusfamilie handelt. Dementsprechend reagierte auch die Politik zunächst wenig alarmistisch und betonte, dass man sehr gut vorbereitet sei.
Nach diesem anfänglichen Herunterspielen kamen die Bilder aus Italien, insbesondere aus Bergamo. Heute weiß man, dass dort kein Massensterben stattfand – aber es starben deutlich mehr Menschen als während einer normalen Grippewelle. Mittlerweile wurde auch rekonstruiert, wie es dazu kam: Zum Zeitpunkt des Ausbruchs gab es noch die Anweisung der WHO, dass Tests nur bei Personen durchzuführen sind, die Verbindungen nach China hatten – dementsprechend wurde die Pandemie erst mit großer Verzögerung entdeckt und auch nur weil ein Arzt das WHO-Protokoll brach. Es waren zudem kaum Tests verfügbar, um die Ansteckungen überhaupt zu entdecken. Die italienische Regierung verzögerte die Abschottung der Region zusätzlich – wahrscheinlich weil die großen regionalen Wirtschaftsunternehmen vor wirtschaftlichen Einbußen warnten.
Dies führte zu einem ungehinderten Ausbruch von Corona. Auf diese Weise starben deutlich mehr Menschen als gewöhnlich – auch weil das gesamte Gesundheitssystem kollabierte und auch andere Notfälle nicht mehr versorgt werden konnten. Auf solche Ereignisse sind Bestattungsunternehmen nicht eingestellt. Da die Verbreitungswege von Corona noch unklar waren, kam hinzu, dass alle Leichen eingeäschert werden sollten – normalerweise wird dies nur mit weniger als der Hälfte der Toten getan. Dies führte dazu, dass Leichen vom Militär abtransportiert werden und zu anderen Krematorien gebracht werden mussten. Die Bilder dieses Transports gingen um die Welt.
Sie trafen auf Medien, die bei Katastrophen einen Wettbewerb um die dramatischsten Bilder und Stories beginnen, weil der Ausnahmezustand eine hohe Quote verspricht. Diese auf Negativität und Katastrophenszenarien fixierten Medien änderten die Beurteilung von Corona Anfang März 2020 gravierend – aus der anfänglichen Grippe wurde, da die Übertragungswege und die Mortalität weiterhin unklar waren, eine lebensbedrohliche Seuche, die mit allen der Regierung zur Verfügung stehenden Maßnahmen verhindert werden musste. Eine Einordnung der Bilder aus Bergamo und der dazugehörigen Zahlen durch die Medien war jedoch zu diesem Zeitpunkt nur schwer möglich, da noch viel zu wenig über die Krankheit bekannt war.
Die deutsche Bevölkerung war durch die Bilder aus Bergamo geschockt und verängstigt: Viele Menschen hatten Angst davor, auf einem Bürgersteig zu nah aneinander vorbeizulaufen. Die Angst führte dazu, dass die Menschen sich sehr folgsam an alle Maßnahmen hielten und ihre Mobilität extrem reduzierten. Dabei waren die Maßnahmen der ersten Welle eher improvisiert: Das ganze öffentliche und private Leben wurde heruntergefahren – und damit auch die Wirtschaft. Das funktionierte europaweit sehr gut – auch weil der Sommer kam und sich das gesellschaftliche Leben nach draußen verlagerte. Um das Leben in geschlossenen Räumen wie Cafés, Theater, Kinos oder dem Einzelhandel wieder zu ermöglichen, wurde dort eine Maskenpflicht eingeführt – auch wenn der Nutzen der damals verwendeten Alltagsmasken nicht nachgewiesen war.
Deutschland hatte die erste Welle im März und April deutlich besser überstanden als die meisten anderen europäischen Länder. Die Infektionszahlen waren relativ hoch (aus heutiger Sicht allerdings immer noch unterschätzt), die Todeszahlen blieben aber erstaunlich niedrig. Deutschland galt mit seiner Strategie des Testens weltweit als ein Musterschüler der Corona-Bekämpfung.
Die Hoffnung des Sommers 2020 und eine politische Langfriststrategie
Im Sommer 2020 gab es insgesamt nur noch wenige Fälle, aber auch einige Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen. Ansonsten wurde im Sommer 2020 darüber diskutiert, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben sollte, und daran geglaubt, dass die Einführung einer Corona-Kontaktverfolgungs-App ein Wiedererstarken von Corona verhindern würde.
Dass man glaubte, Corona auf diese Weise mit der App und mit den Masken im Winter verhindern zu können, führte auch dazu, dass an den entscheidenden Stellschrauben, die für die Dramatik der Pandemie sorgten, nicht gearbeitet wurde. Der Engpass, das war im Frühjahr 2020 immer wiederholt worden, seien die Beatmungsgeräte auf den Intensivstationen. Kurzfristig hatte die Politik einige Maßnahmen ergriffen, um die Situation in den Krankenhäusern zeitweise zu verbessern: Die Betreuungsschlüssel wurden ausgesetzt, es wurden Prämien für freigehaltene Betten gezahlt, es wurde ein Intensivbettenregister eingerichtet und es wurden Prämien für neu eingerichtete Intensivbetten gezahlt. Diese Sonderregelungen liefen im August und September aus. Zu diesem Zeitpunkt waren die Corona-Zahlen weiterhin niedrig und viele Krankenhäuser waren aufgrund der Regelungen und der Angst der Menschen, sich in ein Krankenhaus zu begeben, über das ganze Jahr betrachtet deutlich unterausgelastet gewesen. Für die Politik bestand keine Notwendigkeit, das Gesetz zu verlängern – zumal man auch nicht an eine neue Corona-Welle im Herbst glaubte.
Dies passte aber auch gut zur politischen Langfrist-Strategie im Gesundheitswesen: Die Politik wollte, unterstützt von ThinksTanks und Lobbygruppen, das Gesundheitswesen umstrukturieren, um es für Investoren und Krankenhauskonzerne attraktiver zu machen. Wichtigster Kostensenkungsfaktor sowohl im Krankenhaus als auch in den Pflegeeinrichtungen sind dabei die Personalkosten: Immer weniger Personal ist für immer mehr Patienten verantwortlich. Für diese Stoßrichtung der Politik kam die Corona-Pandemie, vorsichtig formuliert, sehr unpassend: Es ist für die Bevölkerung nicht ersichtlich, warum man bei einer nationalen Notlage wie Corona, Strukturen abbauen sollte, die helfen die Pandemie einzudämmen. Zudem wurde das deutsche Gesundheitssystem mit seiner hohen Krankenhausdichte international viel gelobt und war besser auf Corona vorbereitet als die Krankenhäuser der meisten anderen Länder. Die Strategie der Politik war daher den Bedarf an Krankenhäusern und Pflegepersonal, der durch Corona entstand, zu untertunneln: Wenn die Pandemie erst einmal vorbei ist, kann die Langfriststrategie auch wieder verfolgt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte man nichts machen, was diese Langfriststrategie in der Zukunft behindern könnte. Schön pointiert wurde dies vom Postillon hier dargestellt.
Dieser von Corona unabhängige Umbau des Gesundheitswesens war auch der Grund dafür, dass im Jahr 2020 mehrere kleine Krankenhäuser aufgrund von geringer Rentabilität geschlossen wurden und die Versorgung durch größere Krankenhäuser übernommen wurde. Dies wurde von Kritikern häufig angeführt, um zu beweisen, dass es der Regierung gar nicht um die Bekämpfung von Corona ginge. Correctiv versuchte dies in einem Faktencheck als Gerücht zu widerlegen. Die akribische Recherche bestätigt durch die Schilderung der einzelnen Schließungen und Verlegungen aber zugleich auch die dahinterstehende Langfriststrategie einer zunehmenden Zentralisierung und Profitorientierung im Gesundheitswesen.
Die Wissenschaft
Die Wissenschaft hatte während der ersten Welle große Fortschritte im Verständnis von Corona gemacht. Es bildete sich ein wissenschaftlicher Konsens heraus: Corona wird durch Aerosole übertragen und ist etwa zehn mal tödlicher als eine normale Grippe. Die Sterblichkeitsrate bei einer Infektion beträgt laut einer Metastudie 0,23 Prozent. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter an: Kinder unter 10 Jahren haben ein Risiko von 0,002 %, bei Personen im Alter von 55 Jahren beträgt das Risiko bereits 0,4 % (wenn sie keine Vorerkrankungen haben). Besonders gefährdet sind aber ältere Menschen über 85 Jahren, deren Risiko an einer Corona-Infektion zu sterben sehr hoch ist (15 Prozent). Die Sterblichkeit variiert allerdings auch von Land zu Land – abhängig von der Alterszusammensetzung der Bevölkerung und den medizinischen Versorgungsstrukturen (vgl. hier, Anmerkung: In dieser Grafik ist allerdings nicht die oben genannte Infektionssterblichkeit gezeigt, sondern die Fallsterblichkeit dargestellt – eine Erklärung des Unterschiedes findet sich hier).
Die wissenschaftlichen Vorschläge zur Bekämpfung von Corona basieren auf diesem Wissen. Grundsätzlich sollten die Risikogruppen geschützt werden. Doch in der Frage, wie kann man diesen Schutz am besten gewährleisten kann, gibt es unterschiedliche Ansätze. Der in den meisten westlichen Ländern schon während der ersten Welle verfolgte Ansatz ist es, zu versuchen durch generelle Lockdowns und Einschränkungen der sozialen Kontakte die Infektionszahlen möglichst niedrig zu halten. Damit verringert man die Wahrscheinlichkeit, dass sich beispielsweise das Personal von Altenheimen mit Corona infiziert und die dort befindliche Risikogruppe ansteckt. Gleichzeitig verhindert man durch die niedrigen generellen Infektionszahlen, dass sich Ältere und Vorerkrankte im öffentlichen Leben anstecken. Ideal wäre aus dieser Sicht ein kompletter Shutdown des öffentlichen Lebens für drei Wochen.
Diese Sichtweise wird von einer kleineren Gruppe von Wissenschaftlern in Frage gestellt: Die Infektionszahlen niedrig zu halten sei im Herbst und Winter sehr unrealistisch und würde immer neue Lockdowns erfordern. Sie betonen stattdessen die Unterschiedlichkeit des Risikos: Man müsse sich auf den Schutz der Risikogruppen konzentrieren und dafür nicht das komplette öffentliche Leben stilllegen („Focused protection“). Die komplette Stilllegung führe nicht nur zu katastrophalen Folgen für die Wirtschaft und vermehrten psychischen Problemen in der Bevölkerung, sondern habe auch medizinische Folgen, da viele Menschen nicht mehr zum Arzt gehen und auch viele Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr durchgeführt werden. In dieser Sichtweise können nicht-gefährdete jüngere Menschen unter Einhaltung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen ihr normales Leben weiterführen. Unklar ist allerdings, wie die Risikogruppen konkret geschützt werden sollen, wie beispielsweise das Eintragen von Infektionen in Altenheimen durch das Personal verhindert werden soll. Hier fordern die Vertreter kreative und individuelle Lösungen.
Diese Strategie sei unsolidarisch, betont die erste Wissenschaftlergruppe, weil sie die Bekämpfung der Pandemie nur den Risikogruppen überlasse und diese zwinge, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, während der Rest der Gesellschaft einfach weiterleben könne. Zudem könne man nicht klar unterscheiden, wer zur Risikogruppe gehöre und wer damit geschützt werden müsse.
Die berechtigte Gegenfrage ist allerdings, ob es solidarischer ist, wenig gefährdete Personen einer großen psychischen und wirtschaftlichen Belastung auszusetzen, die teilweise gravierende Folgen für die persönliche Zukunft haben kann.
Man muss aber auch berücksichtigen, dass die Bekämpfung einer Pandemie in den Forschungsbereich von verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen fällt. Die Lockdown-Befürworter sind unter den Virologen höchstwahrscheinlich in der Mehrheit. Allerdings gibt es auch andere Forschungsgebiete, die sich mit der Verbreitung von Epidemien auseinandersetzen und die eher einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz verfolgen, die Versorgungsforschung oder Public Health beispielsweise. In diesen Disziplinen dürfte der Anteil der Lockdown-Befürworter geringer sein. In dem wissenschaftlichen Konflikt geht es also auch um die Frage, welche Disziplin die Deutungshoheit über die Bekämpfung der Pandemie hat: Die Forscher, die das Virus direkt untersuchen, oder die Forscher, die neben der Bekämpfung auch die gesellschaftlichen Konsequenzen berücksichtigen.
Eine offene wissenschaftliche Diskussion dieser unterschiedlichen Ansätze fand nicht statt. (Eine Ausnahme findet sich hier.) Für die Wissenschaftler der ersten Gruppe war die Position der anderen Wissenschaftler scheinbar so, als ob jemand den wissenschaftlichen Konsens beim Klimawandel leugnen würde. Solchen Positionen durfte man in der Öffentlichkeit keinen Raum geben – sonst adelte man sie als gleichberechtigte wissenschaftliche Position. Das Diskussionsklima in der Wissenschaft war und ist vergiftet. Wie sich die Positionen in der Wissenschaft verteilen, ist unklar, da eine Äußerung, die dem ersten Ansatz widersprach, mit einem enormen öffentlichen Prestigeverlust einherging. So geschah es beispielsweise dem renommierten und vielzitierten Stanford-Professor John Joannidis, der als Statistiker (und nicht als Virologe) versuchte, eine relativierende Position einzunehmen.
Dieses Klima lag auch daran, dass die Wissenschaft noch nie eine solche Bedeutung und einen solchen Einfluss auf kurzfristige Entwicklungen hatte wie in dieser Krise. Handlungsempfehlungen der Wissenschaft konnten zu einer größeren Zahl an Toten führen und katastrophale Zustände auslösen. Inwieweit die Wissenschaft hier auch vor dem Hintergrund der medialen Bilder aus Bergamo argumentierte, kann nur schwer eingeschätzt werden. Dem zweiten Ansatz wurde jedenfalls häufig (fälschlicherweise) vorgeworfen, dass diesem Ansatz zu folgen, bedeuten würde, dass man nichts tue und damit solche katastrophalen Zustände erzeuge.
Ein weiterer Grund für das vergiftete Klima war, dass gerade in der Wissenschaft immer auch eine hohe persönliche Identifikation mit einer Theorie oder einem Modell stattfindet. Eine Kritik daran ist somit immer auch eine Kritik an der Person – auch wenn dies natürlich der idealtypischen Vorstellung von Wissenschaft als einer Form der freien und offenen Suche nach dem besten Argument (und letzten Endes der Wahrheit) widerspricht. Die Wissenschaftler identifizieren sich mit einem zusammenhängenden Set an Theorien und Vorstellungen wie Corona zu bekämpfen ist – einem sogenannten wissenschaftlichen Paradigma. Ein solches Paradigma kann lange Zeit die wissenschaftliche Sichtweise auf ein Phänomen beherrschen und andere Theorien und Ansätze unterdrücken – es wird erst abgelöst, wenn zu viel Kritik daran aufkommt und eine alternative Vorstellung plausibler erscheint, der immer mehr Vertreter folgen. Der Begriff des Paradigmas wird in diesem Artikel des Tagesspiegels sehr anschaulich erklärt.
Die Entstehung eines solchen wissenschaftlichen Paradigmas dauert normalerweise recht lange. In der Coronakrise entstand dieses Paradigma sehr schnell – wahrscheinlich auch durch die Dringlichkeit, mit der die Politik Antworten aus der Wissenschaft erwartete. Die erste Gruppe hatte sich mit ihrer Strategie zur Bekämpfung von Corona voll und ganz durchgesetzt – auch wenn Vorschläge zu einer differenzierteren Vorgehensweise im Sinne der zweiten Strategie von der Bevölkerung immer wieder begrüßt wurden und von den Wissenschaftlern der ersten Gruppe massiv bekämpft werden mussten.
Die Idee der maximalen Kontaktvermeidung
Aber zurück zum Sommer 2020. In der Politik und in den Medien herrschte die Hoffnung vor, dass es im Herbst und Winter keine zweite Welle geben würde. Die Warnungen der Virologen und der Modellrechner, einer Gruppe von Mathematikern, wurden nicht ernst genommen – einen zweiten Lockdown sollte es nicht geben. Dass dann eine zweite Welle kam (was auch ohne die Modellrechnungen wahrscheinlich war), wurde von der überraschten Politik und den ebenso überraschten Medien als prophetische Qualität der Virologen und Modellrechner verstanden. Diese Gruppe um Christian Drosten und Lothar Wieler hatte auch schon während der ersten Welle eine große Deutungsmacht besessen. Ab diesem Zeitpunkt hatte sie die komplette Deutungshoheit über die Krankheit gewonnen und die wesentliche Beratung der Politik übernommen.
Ihre Strategie zur Bekämpfung von Corona war es, wie oben beschrieben, die Zahlen durch Lockdowns und Kontaktbeschränkungen so niedrig wie möglich zu halten: Alle nicht-notwendigen Kontakte sollten vermieden werden. Es sollte dabei nicht differenziert werden, welcher soziale Kontakt wirklich gefährlich sein könnte – soziale Kontakte wurden generell als gefährlich eingestuft. Diese Idee der maximalen Kontaktvermeidung basierte am Anfang sicherlich auch auf unklaren Daten zu den Ansteckungswegen – allerdings hätte bereits nach der ersten Welle beschlossen werden können, dass man Studien durchführt und Kontaktdaten der Gesundheitsämter auswertet (vgl. hierzu „Die Datenerhebungskatastrophe“). Diese Idee hatte gravierende gesellschaftliche Folgen: Es wurden der Einzelhandel, die Hotels, die Kultur und die Gaststätten geschlossen. Auch wenn immer wieder Studien auf deren geringen Beitrag zum Infektionsgeschehen verwiesen, konnten sie die Grundidee der maximalen Kontaktvermeidung nicht generell in Frage stellen.
Die großen Unternehmen wurden allerdings nicht geschlossen – auch wenn dies eine wichtige Forderung der Wissenschaft war, um die Mobilität zu senken. In dieser Frage kollidierte die Strategie der Wissenschaft jedoch mit den Vorstellungen der Politik: Das wichtigste Prinzip der Politik in der zweiten und dritten Welle war es, dass die großen Unternehmen nicht (noch einmal) leiden sollten.
Die Umsetzung durch die Politik
Selten war die Politik so abhängig von der Beratung durch die Wissenschaft wie in dieser Krise. Normalerweise wird die Position der Wissenschaft bei politischen Entscheidungen als eine Position unter vielen berücksichtigt. Die Politik kann sich optional auf Aussagen aus der Wissenschaft berufen, wenn sie ihre Entscheidungen begründen will – meist werden wissenschaftliche Analysen aber anderen, beispielsweise wirtschaftlichen Interessen untergeordnet.
In der Corona-Krise benötigte die Politik aber die Beratung der Wissenschaft, um ihre Maßnahmen abzusichern und die Bürger von deren Wirksamkeit zu überzeugen. In der Wissenschaft hatte sich, wie oben beschrieben, die Gruppe durchgesetzt, die ein komplettes Herunterfahren des öffentlichen Lebens als einzige Chance zur Bekämpfung von Corona sah. Diese Wissenschaftler wurden sehr eng in alle politischen Entscheidungen einbezogen. Die Krise wurde als eine virologische Krise verstanden – dementsprechend wurden im Wesentlichen nur Virologen und Modellierer konsultiert. Wissenschaftler aus anderen Disziplinen, die die Folgen der von der Politik und der Wissenschaft verfolgten Lockdown-Strategie beschreiben konnten, wurden von der Politik hingegen nur marginal eingebunden.
Allerdings setzte die Politik von den Forderungen der einbezogenen Wissenschaftler nur das um, was nicht der Wirtschaft schadete, was nicht mit ihren langfristigen Strategien kollidierte und was zugleich nicht zu kostenintensiv oder zu aufwändig war. Die Politik verstand Corona vermutlich als kurzfristiges Ereignis, das nach zwei Jahren und der Impfung endet. Daher lohnte es nicht langfristige Maßnahmen zu ergreifen, die viel Geld kosten – zum Beispiel alle deutschen Schulen mit Luftfiltern auszustatten – oder langfristige Privatisierungsstrategien torpedieren (siehe oben). Stattdessen setzte man lieber auf weniger kostspielige und kurzfristige Maßnahmen wie eine Maskenpflicht, regelmäßige Tests oder Ausgangssperren.
Die Auslastung der Intensivbetten
Seit Mitte Oktober 2020 stieg die Auslastung der Krankenhäuser durch Corona wieder deutlich an (vgl. DIVI). Um die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden, wollte die Politik die Krankenhäuser wieder finanziell unterstützen, so dass planbare Eingriffe verschoben und mehr Betten für Corona-Patienten freigehalten werden konnten. Die oben beschriebenen politischen Maßnahmen der ersten Welle hatten bei einigen Krankenhäusern zu Mitnahme-Effekten geführt: Betten wurden beispielweise von psychiatrischen Kliniken leer gelassen, weil es lukrativer war, die Freihalteprämie zu erhalten. Bereits im Juli hatte die Politik daher die Freihalteprämien abgestuft. Solche Fehlanreize wollte die Regierung bei der Neuregelung im November verhindern und knüpfte daher den Erhalt der Freihalteprämie an die Versorgungsleistung des Krankenhauses, die Inzidenz im Landkreis und die Auslastung der Intensivbetten: Die Sieben-Tage-Inzidenz müsse über 70 Coronafälle pro 100.000 Einwohner liegen und die Auslastung der Intensivbetten mindestens sieben Tage lang ununterbrochen bei über 75 Prozent liegen.
Der zweite Wert wird basierend auf dem neu eingeführten Intensivregister DIVI ermittelt. An diesem Register wurde vermehrt auch Kritik geübt, da die Anzahl der verfügbaren Intensivbetten stark schwanke. Tatsächlich stieg die Anzahl der Intensivbetten während der ersten Welle deutlich an, da viele Krankenhäuser neue Intensivbetten auswiesen, um die ausgesetzte Prämie von 50.000 Euro zu erhalten. Das war insbesondere auch deshalb möglich, weil sie das für den Betrieb dieser Betten notwendige Personal nicht vorhalten mussten, da der Pflegeschlüssel ausgesetzt worden war. Als diese Sonderregelung Ende Juli endete, sank die Zahl der betreibbaren Betten in diesem Register um etwa 6000 Betten.
Mit der Einführung des neuen Gesetzes im November sank die Anzahl der verfügbaren Betten erneut. Im Saarland pendelte sich beispielsweise die Auslastung der Intensivbetten kurz nach Erlass der Regelung tatsächlich bei knapp über 75 Prozent ein. Mitte Dezember korrigierte das Gesundheitsministerium diese Regelung teilweise: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Infektionen je 100.000 Einwohner ist die Auslastung der Intensivbetten nicht mehr für den Erhalt der Freihalteprämie relevant.
So verständlich die Einbeziehung der Intensivkapazitäten der Krankenhäuser war, um erneute Mitnahmeeffekte zu verhindern, so schwer macht es diese Regelung allerdings auch die reale Auslastung von Krankenhäusern in Regionen mit niedrigeren Inzidenzzahlen einzuschätzen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der immer wieder von Wissenschaft und Medien geäußerten Warnung vor einer Überlastung der Krankenhäuser bedeutsam.
Neben dem DIVI-Intensivregister zum Monitoring der Auslastung der Krankenhäuser wurde im November 2020 zudem ein System entwickelt, das die Überlastung der Krankenhäuser praktisch verhindern sollte: Im Rahmen des Kleeblatt-Prinzips können Intensivpatienten aus Regionen mit überlasteten Krankenhäusern in andere deutsche Regionen verlegt werden, in denen mehr Intensivkapazitäten verfügbar sind. Dieses System funktioniert allerdings nur, wenn es in Deutschland auch Regionen gibt, in denen die Krankenhäuser weniger ausgelastet sind – wenn es also keine flächendeckend hohe Überlastung gibt. Die Daten aus diesem System hätte man – zusätzlich zu den Daten des DIVI-Intensivregisters – auch zur Einschätzung der intensivmedizinischen Lage in Deutschland nutzen können.
Die föderale Struktur
Es kann als ein grundsätzliches Motiv der Politik verstanden werden, einen solchen Ausnahmezustand und die damit verbundene Panik in der Bevölkerung zu verhindern. Die oben beschriebene Differenzierungsstrategie wäre politisch nur schwer umzusetzen gewesen – insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass alle europäischen Länder (außer Schweden) auf den Lockdown-Ansatz setzten. Bei dieser Strategie hätte man individuelle, kreative Lösungen finden und viel Angst in der Bevölkerung, falls die Zahlen steigen sollten, abbauen müssen. Gleichzeitig hätte man auch die Medien beruhigen müssen, die ihren skandalorientierten Verarbeitungsmechanismen entsprechend immer wieder hysterisch über Corona-Ausbrüche, steigende Infektionszahlen und überlastete Intensivstationen berichten (dazu gleich mehr). Wenn es steigende Todeszahlen gibt und keine Maßnahmen zur Verhinderung ergriffen werden, werden diese der Politik angelastet.
Um die von der Politik ergriffenen Maßnahmen zu erklären, kommt aber noch ein weiteres politisches Handlungsprinzip hinzu: Wenn eine Krise erkennbar ist, muss Handlungsfähigkeit bewiesen werden. Bei Corona wurde der Nachweis der Handlungsfähigkeit der Politik stark an die Entwicklung der Infektionszahlen geknüpft – insbesondere auch weil die Medien sich sehr stark auf die Berichterstattung dieser Zahlen fokussierten: Gingen diese nach oben, musste dringend politische Handlungsfähigkeit bewiesen werden. Da Deutschland föderal strukturiert ist, gab es drei Ebenen auf denen unterschiedlichste Politikerinnen und Politiker nun ihre Kompetenzen zum Schutz der Bevölkerung beweisen konnten: Auf Bundesebene, auf Landesebene oder auf kommunaler Ebene konnten also zum Beispiel Alkoholausschankverbote, Ausgangssperren, Sperrung von öffentlichen Plätzen, Verbote der Benutzung von öffentlichen Bänken, Maskenpflicht an Rodelhängen, Maskenpflicht in Innenstädten oder generelle Kontaktverbote beschlossen werden. Die meisten Maßnahmen orientierten sich dabei an der oben beschriebenen Idee der maximalen Kontaktvermeidung, verschonten grundsätzlich die Wirtschaft und richteten sich auf das öffentliche Leben. Ob die Maßnahmen allerdings eine wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit gegen die Verbreitung von Corona hatten, war bei den Entscheidungen nur nachrangig – es ging darum das Primat des Handelns zu behalten. Insbesondere durch diesen symbolpolitischen Aktivismus auf den verschiedenen föderalen Ebenen hat die Politik bei der Bevölkerung vermutlich viel an Vertrauen verloren.
Mediale Verarbeitungsstrukturen und Haltungsjournalismus
Von den Medien wurde dieses Potpourri an politischen Maßnahmen generell unterstützt und nur punktuell kritisiert. Wie die Medien auf die Bilder aus Bergamo reagierten, ist oben bereits beschrieben worden. Die Corona-Berichterstattung der Medien folgte auf der einen Seite zunächst den klassischen medialen Aufmerksamkeits- und Verarbeitungsmechanismen: Dramatik und Negativität versprechen Aufmerksamkeit.
In den Medien erschienen ausführliche Home-Stories über Long-Covid-Fälle – insbesondere unter jungen Menschen. Solche Geschichten boten sich für die Medien natürlich an, da sie sehr viele Nachrichtenfaktoren auf sich vereinen konnten – im Gegensatz zu der Geschichte „Alter Mensch stirbt an Corona“. Eine Einordnung der Häufigkeit dieser Symptome fehlte allerdings in diesen Artikeln, weil das Phänomen von der Wissenschaft noch nicht untersucht worden war. Die Prominenz dieser Long-Covid-Artikel führte dazu, dass viele Menschen große Angst vor der Ansteckung entwickelten und die bestehende Gefahr überschätzten.
Ein weiteres wichtiges Merkmal, das auf klassischen medialen Verarbeitungsstrukturen basiert, ist die dramatische Berichterstattung über Länder, in denen Covid außer Kontrolle gerät. Dies begann im Frühjahr 2020 mit Italien und New York, wurde im Januar mit Irland und im Februar mit Portugal fortgeführt und endete vorerst im April mit Brasilien und Indien. Erstaunlicherweise wurde über Tschechien, das im gesamten ersten Quartal 2021 mindestens genauso hart von Corona betroffen war wie beispielsweise Portugal im Februar, nicht in dieser Form berichtet. Über die Beruhigung der Situation in diesen Ländern wurde nur sehr selten berichtet, da dies nicht den medial Aufmerksamkeitsstrukturen entspricht („if it bleeds, it leads“). Durch diese Form der Berichterstattung wurde der Bevölkerung immer wieder verdeutlicht, wie gefährlich Corona ist und was passieren würde, wenn man andere als die beschlossenen Maßnahmen ergreifen würde: Eine humanitäre Katastrophe.
Diese klassische mediale Verarbeitungsweise wurde aber durch eine neue mediale Entwicklung verstärkt. In den 2010er Jahren änderte sich das öffentliche Selbstverständnis von vielen Journalistinnen und Journalisten: Sie wollten in ihrer journalistischen Tätigkeit ihre Haltung und ihre Werte zeigen (vgl. hier). Das bisher vorherrschende Rollenbild im Journalismus war, dass möglichst neutral über die verschiedenen Positionen zu einem Thema berichtet werden sollte. Dieses Bild war natürlich idealisiert und in vielen Bereichen, insbesondere in der Außenpolitik, gab es auch schon früher einen großen medialen Gleichklang. Dass nun aber die nicht-neutrale Berichterstattung als Haltungsjournalismus öffentlich geadelt wurde, war eine neue Entwicklung.
Die ersten Folgen dieser neuen Form des Journalismusverständnisses wurden in der Flüchtlingskrise 2015/16 deutlich. Die Medien wollten, dass die Zuwanderung von Flüchtlingen aus Syrien von den Menschen in Deutschland im Sinne einer neuen „Willkommenskultur“ positiv gesehen wurde und keine Fremdenfeindlichkeit wie in den 90er Jahren daraus entsteht. Das führte dazu, dass es eine einheitlich positive Berichterstattung in den Medien gab, die sich an der von der Politik vorgegebenen Position („Wir schaffen das“) orientierte – alternative Positionen konnten nicht mehr vertreten werden und die Ängste eines großen Teils der Bevölkerung wurden von den Medien ausgeblendet. Dies sind einige der Ergebnisse einer Studie des Journalismusforscher Michael Haller im Auftrag der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung. Haller untersuchte die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise in überregionalen Medien und in Lokalmedien mit dem (relativ hohen) Anspruch, dass Massenmedien die verschiedenen Meinungen einer Gesellschaft widerspiegeln sollten. Er kommt zu dem Schluss, dass „die Kommentare grosso modo nicht dem Ziel [dienten], verschiedene Grundhaltungen zu erörtern, sondern dem, der eigenen Überzeugung bzw. der regierungspolitischen Sicht Nachdruck zu verleihen.“ (S. 135) In der Flüchtlingskrise bildeten die Massenmedien also nicht widerstreitende gesellschaftliche Ansichten ab, sondern schränkten den Meinungskorridor im öffentlichen Raum auf das ein, was von der Politik vorgegeben worden war und von den Journalisten als moralisch richtig begrüßt wurde. Als Konsequenz dieser einseitigen und manipulativen Berichterstattung, glaubt „ein beachtlicher Teil der Bevölkerung […] seither, der Journalismus werde offenbar gezwungen, systemkonform und insofern manipulierend zu berichten.“ (S. 142) Kritische Meinungen jenseits der offiziellen Linie wurden in den Medien als rechts abgewertet. Die davon Betroffenen zogen sich in alternative Kommunikationskanäle zurück und nutzten zunehmend die sozialen Medien. Dort fanden sie „Echokammern“ und „Filterbubbles“ vor, die zu einer Radikalisierung ihrer Positionen beitrugen, die von den Medien nun häufig beklagt wird. Gerade weil der Journalismus die Funktion nicht mehr erfülle, so fasst Haller zusammen, öffentliche Verständigungsprozesse zwischen verschiedenen Meinungen in Gang zu bringen und darzustellen, entstehen diese voneinander abgeschotteten Kommunikationsinseln.
Der mediale Gleichklang und Twitter
Diese Entwicklung setzte sich in der medialen Berichterstattung erst über den Klimawandel und dann über die Corona-Krise fort. Während es bei der Flüchtlingskrise darum ging, negative rechte Einstellungen und Taten gegenüber Flüchtlingen zu verhindern, geht es bei der Corona-Krise darum, Corona-Tote und die Überlastung der Intensivstationen zu verhindern. Die Bevölkerung muss daher von der Notwendigkeit der politischen Maßnahmen zur Bekämpfung überzeugt und beim Befolgen der Maßnahmen angeleitet werden. Die Medien folgen hier wieder den Vorgaben der Politik. Kritische mediale Diskussionen beschränken sich auf die Sinnhaftigkeit einiger weniger Maßnahmen der Politik, zum Beispiel Friseuröffnungen, Schulöffnungen oder Ausgangssperren. Unterstützt werden die Medien dabei von „der“ Wissenschaft – in Form der oben beschriebenen Gruppe von Virologen und Modellierern. Um so mehr sehen sich die Medien in dieser Frage auf der Seite der Vernunft und des Richtigen.
Aber können die Medien überhaupt Positionen beziehen, die von niemandem in der öffentlichen Arena vertreten werden? Sie sind schließlich auf prominente Sprecher angewiesen, um deren widerstreitende Positionen darzustellen. Spiegeln die Medien also nur den Gleichklang in Politik und Wissenschaft wider? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht: Die Berichterstattung verstärkte den vorhandenen Gleichklang noch, indem die Medien durch die Skandalisierung anderer Ansätze bewusst dafür sorgten, dass andere Sprecher in der öffentlichen Arena nicht mehr – ohne Angst vor Gesichtsverlust – auftauchten konnten. Dabei hätten gerade die Medien auch andere Experten zu Wort kommen lassen können, die die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Politik thematisieren.
Tatsächlich erschienen sogar auch einige Berichte, die auf die Folgen des von der Politik verhängten Lockdowns aufmerksam machten: Über zunehmende häusliche Gewalt, über die gravierenden psychologischen Folgen und die Probleme des Einzelhandels, der Kulturschaffenden oder von Gaststätten- und Hotelbetreibern. Mit großem journalistischen Eifer wurde auch über die Masken-Affäre der CDU berichtet – möglicherweise um der Öffentlichkeit (und sich selbst) zu beweisen, dass man auch noch kritisch über die Regierung berichten kann. Dennoch wurde jeder Versuch, der eine Änderung der zugrundeliegenden Politik auch nur andeutete, massiv skandalisiert – beispielsweise falls die Effektivität von Lockdowns, die Inzidenzzahlen, die Überlastung der Intensivstationen oder die mediale Berichterstattung in Frage gestellt wurde oder wenn die gesundheitlichen Folgen betont wurden. Die Berichterstattung folgte dabei einem Muster: Die kritischen Aussagen wurden zunächst sehr kurz dargestellt, um dann voller Empörung direkt von mehreren Experten der oben genannten Wissenschaftler-Gruppe als völlig falsch widerlegt zu werden und auch als Weg zu mehr Toten auf den Intensivstationen verteufelt zu werden. Zusätzlich kommentierten die Journalistinnen und Journalisten die Vorschläge abschließend nach dem verständnis-simulierenden Muster: „Wir alle leiden doch unter den Maßnahmen, aber sie sind alternativlos.“
Dies ist allerdings nur ein persönlicher Eindruck, der hier mit einigen beispielhaften Artikeln illustriert wurde. Ob die Medien tatsächlich in einem solchen Gleichklang berichtet haben, werden wohl erst kommunikationswissenschaftliche Studien im Nachhinein eindeutig nachweisen können. Die Medien sind sich zumindest keiner Schuld bewusst, sondern wohl eher stolz auf ihre wissenschaftsjournalistische Vermittlungsleistung. Michael Haller konstatiert in seiner Studie zur Flüchtlingskrise im Jahr 2017: „Auf dieser Ebene [der strukturellen, N.K.] verweisen die Ergebnisse auf gravierende Dysfunktionen des Informationsjournalismus […]. Diese Störungen haben sich so tief eingefressen, dass sie von Journalisten oder einzelnen Redaktionen vermutlich für normal gehalten, das heißt nicht als solche wahrgenommen oder gar problematisiert werden.“ (S. 141)
Ein Grund für diese Betriebsblindheit liegt sicherlich auch an der zunehmenden Nutzung des Nachrichtendienstes Twitter. Twitter dient Journalisten, Politikern und Wissenschaftlern als Selbstvergewisserungsmedium: Dort steht der öffentliche Pranger, auf dem falsche Aussagen als erstes skandalisiert und verhöhnt werden können und damit auch die Richtigkeit der eigenen Position durch alle relevanten Anderen bestätigt werden kann. Die meisten vom medialen Konsens abweichenden öffentlichen Äußerungen wurden, bevor die mediale Berichterstattung darüber überhaupt einsetzen konnte, dort schon eingeordnet und kommentiert – teilweise schafften es die Twitter-Kommentare dann auch in die mediale Berichterstattung. Auch aufgrund dieses extrem schnellen Vorab-Meinungsbildungsmechanismus sollte der Verstärkungseffekt dieser Plattform nicht unterschätzt werden.
Seit die Medien nicht mehr den Raum für Diskussionen zwischen verschiedenen Positionen bieten, ist Twitter allerdings auch einer der letzten Orte (neben Facebook), an dem noch öffentliche Diskussionen ausgetragen werden können. Der Ton ist allerdings, wie in der Wissenschaft auch, vergiftet und nicht auf Meinungsaustausch ausgerichtet: Die meiste Aufmerksamkeit gewinnen die Kommentare, die Aussagen sarkastisch und ironisch drehen oder dramatische Vergleiche ziehen. Eine Polarisierung der Positionen folgt bei dieser Grundstruktur fast zwangsläufig.
Diese Polarisierung des öffentlichen Raums hat auch gravierende zwischenmenschliche Folgen. Die großen Krisen der letzten Jahre (Bankenkrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise) hatten nur indirekte Auswirkungen auf den tatsächlichen Lebensalltag der meisten Menschen. Die Corona-Krise verändert hingegen den Lebensalltag der allermeisten Menschen und greift tief in die Lebensgestaltung ein. Dementsprechend müssen sich die meisten Menschen zu diesen Veränderungen auch positionieren. Dass die Medien in einer solchen Situation die gesellschaftlich vorhandenen Positionen nur extrem polarisiert als falsch oder richtig darstellen, führt auf zwischenmenschlicher Ebene zu starken Spannungen: Die im öffentlichen Raum nicht zuvereinbarenden Positionen werden im privaten Raum als Stellvertreterkriege fortgeführt und zerstören so Freundschaften und auch Beziehungen. Wenn alle gesellschaftlich relevanten Positionen in den Medien von prominenten Personen vertreten werden würden und dort in Diskussionen nebeneinander stehen könnten, könnte die Bevölkerung sich in privaten Gesprächen auf diese Diskussionen berufen und müsste nicht so erbittert darüber streiten. Die Medien berichten indes auch über diese privaten Kleinkriege – ohne allerdings den Grund für die Verwerfungen in ihrer eigenen Berichterstattung zu suchen.
Die Rechten und die gespaltene Linke
In der Bevölkerung traf die Polarisierung in Medien, Politik und Wissenschaft auf unterschiedliche Strömungen: Das klassische Links-Rechts-Schema kann die Reaktionen der gesellschaftlichen Gruppen nur teilweise erklären. Die Wirkung der Corona-Maßnahmen kann eher auf der liberalen Achse eingeordnet werden – als ein zu großer Eingriff des Staates in die Privatangelegenheiten seiner Bürger. Wie sehr die weltweiten Coronamaßnahmen die politischen Landkarten durcheinander wirbeln, erkennt man beispielsweise daran, dass viele staatsablehnende Republikaner das schwedische Modell (dazu später mehr) befürworten – obwohl Schweden ja noch immer ein Musterbeispiel eines stark regulierenden Sozialstaats ist.
Dass der Staat sich nicht in das Privatleben der Bürger und in die Wirtschaft einmischen soll, ist eine klassische Position von Konservativen und Liberalen. Gerade dieses Prinzip wird durch die Corona-Maßnahmen massiv verletzt. Nicht umsonst wurde die größte Gegenbewegung gegen Corona, Querdenken, von einem ehemaligen Unternehmer aus Baden-Württemberg gegründet. Die extreme Rechte geht noch weiter und kritisiert nicht nur die staatlichen Eingriffe zur Bekämpfung von Corona, sondern sieht darin eine Verschwörung der Eliten, um die Bürger zu kontrollieren. Die Impfung werde dazu genutzt, die Bevölkerung unfruchtbar zu machen – ganz im Sinne der großen Austauscherzählung.
Schon während der Flüchtlingskrise hatten die Rechten von der scharfen Grenzziehung innerhalb der Medien profitiert: Wer nicht für diese Form der massenhaften Einwanderung war, war rechts. Auch in der Corona-Krise profitieren die Rechten wieder von einer ähnlichen Grenzziehung: Wer nicht für die Maßnahmen ist, ist ein Verschwörungstheoretiker und rechts. Jegliche grundlegende Kritik an den Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona und zur Berichterstattung in den Medien, wurde so diffamiert. Dabei nutzen die Rechten einen einfachen Reflex der Medien, um diese kritischen Positionen zu besetzen: Sie müssen nur einer kritischen Äußerung zustimmen und Beifall zollen, dann wenden sich die Medien angeekelt von der Äußerung und dem Argument ab. Auf diese Weise werden sie von der Bevölkerung als die einzige kritische Stimme gegen diese Politik wahrgenommen. Die ursprünglich kaum relevante europakritische Partei AfD ist durch die mediale Berichterstattung über die Flüchtlingskrise und diesen einfachen Mechanismus vor vier Jahren zur größten Oppositionspartei im deutschen Bundestag geworden. Auch in der Corona-Krise werden wieder viele von der Politik Enttäuschte ihren Weg zur AfD finden. Allerdings wird sich die AfD, insbesondere im Westen, die Stimmen der Enttäuschten auch mit der FDP teilen müssen, die sich als bürgerliche, also weniger rechte Hüterin der Bürgerrechte profiliert.
Wie schon in der Flüchtlingskrise haben die Linken das gesamte Feld der Kritik den Rechten überlassen. Im Unterschied zur Flüchtlingskrise ist die Linke aber in der Corona-Krise plötzlich gespalten: Ein großer Teil der Linken hatte sich schon lämger auf Identitäten, Diskriminierungen und Minderheitenschutz fokussiert. Für diese Gruppe stand es daher außer Frage, dass man Solidarität mit den gesellschaftlichen Risikogruppen zeigen müsse. Das wissenschaftliche Lockdown-Paradigma wurde komplett übernommen. In dieser Gruppe fanden sich sogar widerstreitende linke Bewegungen wieder: Linke, die an die Macht und das Umverteilungspotential des Staates glauben, und Linke, die den Nationalstaat abschaffen wollen und internationale Grenzenlosigkeit als Ziel haben. Die Zero-Covid-Strategie vereinte beide Positionen, indem sie einen gesamteuropäischen Shutdown fordert, der durch sozialstaatliche Leistungen abgefedert werden soll. Hinzu kommt mit der Forderung eines konsequenten Lockdowns der Wirtschaft auch noch klassisch linke Kapitalismuskritik. Diese Gruppe der Linken wurde zu den härtesten Lockdown-Verfechtern: Jede Maßnahme der Regierung ging ihnen nicht weit genug und jeder Ruf nach Lockerungen wurde als rechts sowie als Weg in eine humanitäre Katastrophe gebrandmarkt. Die mit dem Lockdown einhergehenden sozialen Folgen für einen großen Teil der Bevölkerung wurden entweder – wie in den Medien – als alternativlos dargestellt oder sollten großzügig vom Staat abgefedert werden.
Ein Teil der Linken beurteilte die Corona-Krise jedoch diametral anders: Dies waren zum einen Linke, die der klassischen Medizin skeptisch gegenüberstehen, und zum anderen liberale Linke, die nicht wollen, dass der Staat sich in ihre persönlichen Angelegenheiten einmischt. Die bereits im Sommer 2020 geführte (noch theoretische) Diskussion über einen möglichen Impfzwang und die im ersten Lockdown massiv eingeschränkten Grundrechte verdeutlichten beiden Gruppen, welchen Weg die Politik nehmen würde und wie sie sich positionieren sollten. Viele gingen auf die Straße und demonstrierten dort gemeinsam unter dem Label „Querdenken“. Der Zweifel an der von der Schulmedizin beschriebenen Krankheit Corona war auf der einen Seite das verbindende Element mit den dort demonstrierenden Rechten, die daran glaubten, dass Corona nur eine staatliche Erfindung sei, um andere weitreichendere Pläne durchzusetzen. Auf der anderen Seite war die Nicht-Einmischung des Staates für die staatsskeptischen Linken das verbindende Element mit den ebenfalls dort demonstrierenden bürgerlichen Liberalen. Für die weiter oben beschriebene Gruppe der linken Lockdown-Verfechter stellte es einen Tabubruch dar, dass dort (in ihren Augen: ehemals) Linke gemeinsam mit Rechten demonstrierten. Sie organisierten – im Sinne ihres klassischen Kampfes gegen Rechts – Demonstrationen gegen die Querdenken-Demonstrationen.
In den Medien wurde zudem auch sehr stark gegen diese seltsam zusammengesetzten Demonstrationen polemisiert. Dies führte zu einer weiteren Radikalisierung der Teilnehmer dieser Demonstrationen und zu einem Vertrauensverlust in die mediale Berichterstattung bei einer Gruppe, die dies bisher so nicht gekannt hatte. Allerdings änderte sich die mediale Berichterstattung im Laufe der Corona-Krise auch und es wurde etwas differenzierter über diese Demonstrationen berichtet.
Schutz der Altenheime und die Bilanz der zweiten Welle
Doch was passierte während der zweiten Corona-Welle? Wie erfolgreich war die von den Wissenschaftlern vertretene Strategie zur Bekämpfung von Corona?
Die wesentliche Strategie während der zweiten Welle war es, mit Hilfe eines generellen Lockdowns und von Kontaktbeschränkungen die generellen Infektionszahlen niedrig zu halten, und so die Risikogruppen zu schützen. Zunächst wurden in einem sogenannten „Wellenbrecherlockdown“ im November 2020 der Einzelhandel, die Gaststätten, Hotels und die Kulturbranche geschlossen. Dieser „Lockdown light“ wurde im Dezember noch einmal verschärft – allerdings, wie oben bereits beschrieben, ohne die Wirtschaft zu Maßnahmen zu verpflichten.
Der Schutz der Altenheime wurde nicht als prioritär betrachtet – auch weil niemand mit einer zweiten Welle gerechnet hatte. Der Sommer war somit nicht genutzt worden um ein Schutzkonzept für Altenheime zu entwickeln. Grundsätzlich wollte man die Bewohner der Altenheime besser schützen, aber auch verhindern, dass sie noch einmal durch ein Besuchsverbot so isoliert werden wie im Frühjahr. Ein möglicher Weg zum Schutz der Bewohner war das verstärkte Testen des Personals und der Besucher. Im September hatte die WHO in einer Empfehlung eine neue Form von Schnelltests als wissenschaftlich valide Testvariante beurteilt. Im Oktober passte die Bundesregierung die Testverordnung an: Besucher und Bewohner von Altenheimen sollten Schnelltests durch medizinisch geschultes Personal erhalten. Die Altenheime mussten dafür ein einrichtungsbezogenes Testkonzept beim Gesundheitsamt einreichen und darin ihren Bedarf an Schnelltests darlegen. Die Gesundheitsämter waren allerdings durch den Beginn der zweiten Welle überlastet – in einem Interview sagt der Leiter eines Pflegeheims, dass ihm das Gesundheitsamt gesagt habe, das Konzept sei dann genehmigt, wenn er nach zwei Wochen nichts vom Gesundheitsamt gehört hätte. Die Länder bestellten im November auch schon präventiv ein große Menge an Schnelltests. Die Pflegeheime hatten allerdings gar nicht ausreichend Personal, um die Tests durchzuführen, da beispielsweise für jeden Test Schutzkleidung angelegt werden musste. Im Dezember verschärfte die Bundesregierung die bisherige Testregelung für Altenheime noch einmal: Eine mehrmalige Testpflicht des Personals wurde eingeführt und in Regionen mit erhöhter Inzidenz mussten alle Besucher getestet werden. Offen blieb allerdings, wer diese Vorgabe in den Pflegeeinrichtungen umsetzen und die Tests durchführen sollte. Es musste sich um medizinisch geschultes Personal handeln. Die Kommunen wollten das Technische Hilfswerk fragen, der Bund wollte dies nicht – möglicherweise aus Angst vor der Symbolik eines Einsatzes des Katastrophenschutzes in Altenheimen vor Weihnachten. Stattdessen wollte die Regierung eine Hotline der Arbeitsagentur einrichten lassen, bei der sich Freiwillige melden konnten. Der Start der Hotline verzögerte sich allerdings aufgrund von bürokratischen Fragen bis Ende Januar. In der Not wurde die Armee angefragt, deren Einsatz sich ebenfalls durch bürokratische Hürden verzögerte (wo sollten die Soldaten schlafen und wer bezahlt dafür?). Die Satiresendung „Die Anstalt“ fasst die Versuche der Personalgewinnung pointiert hier zusammen.
Das Ergebnis des Lockdowns und des mangelhaften Schutzes der Altenheime: Die Infektionszahlen unter der jüngeren und mobilen Bevölkerung konnten durch den umgesetzten Lockdown stabil gehalten und auch gesenkt werden. Der Effekt, dass dadurch auch die ältere Bevölkerung geschützt werden konnte, blieb jedoch aus: Die Infektionszahlen unter den Älteren stiegen während der zweiten Welle im Dezember und Januar extrem an – bei einem gleichzeitigen Stagnieren und leichten Sinken der Zahlen unter den Jüngeren (vgl. hier, Abb. 7:). Das führte dazu, dass in der zweiten Welle von November bis Januar von allen Toten ein hoher Prozentsatz in Pflegeheimen untergebracht war: Von den 71000 Coronatoten, die bis Anfang März gestorben waren, lebten mehr als 29000 in Pflegeeinrichtungen (41%).
Dass die Pflegeheime nicht geschützt werden konnten, war allerdings kein speziell deutsches Problem. Auch international gelang es kaum, die Pflegeheime zu schützen. Im November 2020 brachte die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC eine Risikoeinschätzung heraus, die neben Handlungsempfehlungen auch erste Zahlen aus anderen Ländern enthielt: In Frankreich starben 45 Prozent der Corona-Toten in Pflegeeinrichtungen, in Belgien waren es 43 Prozent. In den USA waren es im April 2021 35 Prozent der Toten.
Was genau in diesen Ländern geschah, kann hier nicht rekonstruiert werden. Pflegeheime scheinen für das Corona-Virus jedenfalls ideale Verbreitungsbedingungen zu bieten: Auf engem Raum befinden sich viele alte Menschen mit Vorerkrankungen, die täglich längeren Nahkontakt zu Pflegepersonal haben, das aufgrund der personellen Unterbesetzung der Heime kaum eine Chance hat, Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten – geschweige denn als Zusatzaufgabe noch regelmäßige Tests durchzuführen. Hinzu kommt, dass das Pflegepersonal häufig prekär beschäftigt ist und es sich aufgrund der eigenen finanziellen Lage und der Personalsituation im Pflegeheim nicht leisten kann, bei Krankheit zu Hause zu bleiben. Um die Entwicklung der Todeszahlen in den Altenheimen zu verhindern, wäre wohl eine Abkehr von der oben beschriebenen politischen Langzeitstrategie der Privatisierung und eine bessere personelle Ausstattung der Altenheime notwendig gewesen.
Gleichzeitig hätte man auch frühzeitig anerkennen müssen, dass es bekannte Risikogruppen gibt, die prioritär geschützt werden müssen. Es scheint, dass das Konzept des generellen Lockdowns zum Schutz der Risikogruppen eine grundsätzliche Schwachstelle hat, wenn die geforderten Maßnahmen von der Politik nicht komplett im Sinne der Wissenschaft umgesetzt werden – dann gibt es kein Sicherheitsnetz, das die Risikogruppen noch schützen könnte. Wenn noch langsame, entscheidungsunfähige bürokratische Strukturen und ein personell unterbesetztes Pflegesystem hinzukommen, führt dies zu katastrophal hohen Todeszahlen in der Risikogruppe.
Alternative Ansätze und die Wissenschaft
Dass man ältere Menschen besser hätte schützen können, versuchte die Stadt Tübingen mit ihrem alternativen Ansatz zu beweisen. Dieser Ansatz folgte im wesentlichen der „Focused Protection“-Strategie der unterlegenen Wissenschaftlergruppe. Die Strategie wurde zusätzlich zu den bestehenden bundesweiten Schutzmaßnahmen umgesetzt und nicht – wie es häufig fälschlicherweise den Wissenschaftlern dieser Gruppe unterstellt wurde – unter Aussetzung aller Schutzmaßnahmen für die jüngere Bevölkerung. Es wurden kreative Wege gefunden, wie die ältere Bevölkerung geschützt werden konnte: Die jüngere Bevölkerung wurde gebeten, nicht am Vormittag einzukaufen, sondern diese Zeit der älteren Bevölkerung zum Einkaufen zu lassen. Ältere Leute konnten Taxis zum Preis eines Nahverkehrstickets nutzen, um nicht den überfüllten öffentlichen Nahverkehr nutzen zu müssen. Zudem wurden Anfang November kostenlos FFP2-Masken an diese verteilt. Vor einem Besuch von älteren Personen konnten die Menschen seit Ende Oktober in Testzentren oder im Pflegeheim einen kostenlosen Schnelltest durchführen. Die Tests wurden durch Freiwillige des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt. Schon seit Anfang September wurde das Personal in Alten- und Pflegeheimen regelmäßig getestet.
In den Medien gab es von Anfang bis Mitte Dezember auch einige Berichte über diesen Tübinger Ansatz, da der Tübinger Oberbürgermeister, Boris Palmer, erklärt hatte, dass es seit einigen Wochen dank des Tübinger Wegs keine Infektionen in den Alten- und Pflegeheimen mehr gegeben habe. In den Medien herrschte allerdings – wie in der Wissenschaft – eine große Skepsis gegenüber den Schnelltests vor, da diese falsche Sicherheit vorgaukeln könnten. Außerdem seien diese Tests und das für die Durchführung benötigte Personal zu teuer. Die Frage war auch, ob dieser Ansatz auf Deutschland übertragbar sei – schließlich sei Tübingen eine akademisch geprägte Kleinstadt. Mitte Dezember galt das Modell dann zumindest in den Medien als diskreditiert, nachdem einige Medien einzelne Fälle in Altenheimen aufgedeckt hatten.
Erstaunlicherweise äußerte sich in den Medien kein einziger der wissenschaftlichen Lockdown-Befürworter zu diesem Ansatz. Zur gleichen Zeit äußerte sich der einer der Hauptvertreter dieses Ansatzes, Christian Drosten, in seinem Podcast allerdings unerwartet abschätzig über ein Thesenpapier seines Professorenkollegen Matthias Schrappe, das einen differenzierten Focused-Protection-Ansatz vorschlug. Er sagte in seinem Podcast unter anderem: „Ein Vorschlag, der hier stark versucht wird zu machen, ist: Man muss sich doch stärker auf das Schützen der Risikogruppe konzentrieren. Das ist richtig. Das würde niemand bestreiten. Nur man muss Dinge mit einer Umsetzungsidee vorschlagen. Das fehlt hier einfach. Also, wenn man nicht beitragen kann, wie man es denn besser hinkriegen kann und dafür auch vielleicht wissenschaftliche Belege zitieren kann, wie man dahin kommt, dann ist das einfach nicht sehr nützlich. Dann macht das bei denen, die sich nicht im Detail auskennen, auch bei den Politikern den Eindruck, die Wissenschaft ist sich nicht einig und man kann sich auf die Wissenschaft gar nicht mehr verlassen.“
Die zeitgleich in den Medien beschriebenen konkreten Tübinger Umsetzungsideen kommentierte Drosten allerdings nicht. Aus seiner Sicht als Wissenschaftler war dies sogar verständlich, da der Tübinger Versuch keinerlei wissenschaftlichen Standards genügte. Daher kann die Frage, ob dieser Ansatz funktioniert hat, leider kaum beantwortet werden. Die Stadt hat (laut Pressestelle) aufgrund ihrer geringen Einwohnerzahl (unter 100.000) keine systematischen Zahlen zur Altersstruktur der Infizierten erhoben – die Tübinger Zahlen wurden gemeinsam mit dem (deutlich größeren) Landkreis erhoben und können von den dortigen Infektionszahlen nicht getrennt werden. Die Berichterstattung über den Tübinger Weg, die Mitte Dezember einsetzte, könnte also – zumindest, wenn man keine genauen Daten hat – auch nur eine PR-Aktion gewesen sein.
Allerdings muss hier auch betont werden, dass die Möglichkeit, wissenschaftlich begleitete Modellversuche auf regionaler Ebene durchzuführen, erst Ende März 2021 von der Politik ermöglicht wurde (und dann mit der Bundesnotbremse einen Monat später – nach einer Welle an Modellprojekten – wieder zurückgenommen wurde). Es gab keine finanzielle Förderung für die Durchführung von wissenschaftlichen Versuchen, die der Lockdown-Idee widersprachen. Die Stadt Tübingen musste die Schnelltests aus ihrem eigenen Budget bezahlen (immerhin 500.000 Euro). Eine Förderung für die wissenschaftliche Begleitung gab es nicht.
Die Forderung von Christian Drosten, dass alternative Ansätze auch wissenschaftlich belegbar sein sollten, ließ sich somit gar nicht umsetzen, weil Forschungsprojekte zu diesen Ansätzen aufgrund der aktuellen Vorstellung der Bekämpfung von Corona gar nicht finanziert wurden. Das erste Forschungsförderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das im März 2020 ausgeschrieben wurde, umfasste bis zu 45 Millionen Euro. Eine Übersicht über die vom BMBF geförderten Projekte im Zusammenhang mit Corona findet sich hier. Neben sehr vielen Forschungsprojekten zu medizinischen Behandlungsaspekten von Corona, finden sich dort drei Projekte zur Frage, wie man möglichst gut den Effekt von Lockdown-Maßnahmen und deren Auswirkung auf das Verhalten der Bevölkerung modellieren kann (CoViDec, CoPREDICT, MoKoCo19). Die ersten Ergebnisse dieser Projekte fanden sich in den Diskussionen zur zweiten und dritten Welle bereits wieder und beeinflussten den medialen Diskurs in einem ängstigenden Sinne. Vier Projekte beschäftigen sich mit dem Thema Risikokommunikation und wie man mit der Bevölkerung in einer Krise kommunzieren sollte, damit Maßnahmen befolgt werden (GICK, RAPID-COVID, RiCoRT, Understand-ELSED). Zwei Projekte untersuchen, welche Rolle Solidarität bei den individuellen Reaktionen der Menschen auf die Maßnahmen spielt (SAFE-19, SolPan). Zwei Projekte erforschen die Entwicklung von Schnelltests (SARS2-MAB-Test, coRNA) und ein Projekt die Optimierung von Masken (BIO-PROTECT-Mask). Außerdem beschäftigt sich jeweils ein Projekt mit den Auswirkungen der Maßnahmen auf die „soziale Gesundheit“ (CoronaCare), den sozioökonomischen Folgen der Maßnahmen (SOEP-CoV), den Folgen für die Gesetzgebung (LegEmerge) sowie mit der Vorausplanung von Corona-Behandlungen in der Altenpflege (BVP-Akut).
Es folgten immerhin noch drei weitere BMBF-Forschungsförderprogramme: Das im Juni 2020 ausgeschriebene Förderprogramm zur Herstellung eines Impfstoffes umfasste bis zu 740 Millionen Euro und wurde an drei Forschungsprojekte vergeben. Im Januar 2021 folgte die Ausschreibung eines Förderprogramms zur Suche nach Medikamenten gegen Corona und im Februar ein Förderprogramm zur Untersuchung der gesellschaftlichen Auswirkungen von Corona. Die geförderten Projekte des Programms zur Suche nach Medikamenten sollten bereits im Mai starten. Beim zweiten Programm wird im Oktober bekannt gegeben, welche Projekte gefördert werden.
Keines dieser Projekte beschäftigte sich allerdings mit der Frage, wie man die Risikogruppen besser schützen könnte. Auch die Erforschung von Medikamenten zur Behandlung von Corona wurde verschlafen aufgrund der vorherrschenden Fixierung auf Impfstoffe. Dass alternative wissenschaftliche Ansätze nicht erforscht werden, ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum sich wissenschaftliche Paradigmen häufig so lange behaupten können. Ein weiterer Grund kann allerdings auch sein, dass wirtschaftliche Interessen hinter der Nicht-Erforschung von Alternativen stehen. In der Corona-Pandemie wird beispielsweise die Effektivität des theoretisch vielversprechenden und günstig herzustellenden Medikaments Ivermectin in keiner wissenschaftlichen Studie in einem westlichen Land untersucht.
Der schwedische Ansatz
Ein Land stellte sich allerdings gegen das wissenschaftliche Lockdown-Paradigma und verfolgte eine anderen Ansatz: Schweden setzte auf die Eigenverantwortung seiner Bürger und nicht auf generelle Lockdowns – dies war teilweise auch durch die schwedische Verfassung vorgegeben. Es traf allerdings nicht zu, dass in Schweden keine Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona beschlossen worden sind. Allerdings wurden deutlich weniger Maßnahmen als im Rest Europas umgesetzt: Der Einzelhandel, die Cafés und Hotels waren nie geschlossen – bei steigenden Infektionszahlen wurde lediglich die zugelassene Anzahl an Kunden begrenzt. Universitäten und Sekundarschulen wurden im Frühjahr 2020 noch geschlossen, im Winter wurden nur die Sekundarschulen geschlossen. Die schwedischen Grundschulen wurden hingegen nie geschlossen. Eine Maskennutzung unter freiem Himmel wurde nie verordnet – bei steigenden Zahlen wurde die Maskennutzung im Nahverkehr im Dezember empfohlen. Größere Versammlungen und Veranstaltungen waren aber im Winter auch in Schweden verboten. Von April bis Oktober 2020 herrschte auch ein Besuchsverbot von Altenheimen. Allerdings konnten sich durchgängig bis zu acht Personen treffen.
Der schwedische Ansatz war auf den Schutz von Risikogruppen ausgelegt. Die nicht gefährdete Bevölkerung sollte sich durch Einhaltung der Hygieneregeln und durch Abstandhalten schützen. Dieser Ansatz war der weltweit am meisten bekämpfte und unter Gegnern des Lockdowns am häufigsten zitierte Ansatz, weil er dem offiziellen wissenschaftlichen Bekämpfungsparadigma widersprach. Dementsprechend umstritten ist auch die Frage, wie erfolgreich dieser Ansatz war.
In der ersten Welle im Jahr 2020 war es in Schweden – wie später in Deutschland – nicht gelungen, die Alten- und Pflegeheime zu schützen: Fast die Hälfte der Toten in der ersten Welle starb in einem Pflegeheim, ein weiteres Viertel starb in häuslicher Pflege. Dies war vor allem auf die schlechten Pflegebedingungen und kaum vorhandene Schutzausrüstung zurückzuführen. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Pandemie gab es kaum Masken oder Tests auf dem internationalen Markt. Außerdem waren auch in Schweden die Pflegeheime privatisiert worden und Personalkosten durch den Einsatz von schlecht ausgebildeten Zeitarbeitern gesenkt worden. Im Herbst 2020 wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, um zu klären, wie es zu den hohen Todeszahlen kommen konnte. Der finale Untersuchungsbericht erkannte an, dass die hohen Zahlen zum einen durch die hohen Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung bedingt waren, aber zum anderen einen wesentlichen Grund für die Todeszahlen in den mangelhaften strukturellen Rahmenbedingungen, die in der Altenpflege in Schweden herrschen.
Im Dezember stiegen die Infektionszahlen in Schweden wieder deutlich an und die Intensivstationen in einigen Regionen waren am Rande ihrer Kapazitäten. Diese Entwicklung und der europaweite politische und mediale Druck führten dazu, dass auch innerhalb Schwedens der eigene Sonderweg auf höchster Ebene kritisiert wurde. Im Januar wurde daher ein Gesetz erlassen, das der Regierung zeitlich begrenzt die Möglichkeit gibt, beispielsweise die Teilnehmerzahl bei öffentlichen Veranstaltungen zu begrenzen und Sanktionen bei Verstößen zu erlassen. Ein ähnliches zeitlich begrenztes Gesetz hatte das Parlament bereits im April 2020 erlassen – die dort möglichen Regelungen wurden allerdings nie eingesetzt. In diesem Jahr nutzte die Regierung das neue Gesetz und führte beispielsweise einige Regeln für den Besuch von Restaurants, Cafes und Bars ein. Allerdings blieben diese trotz der hohen Infektionszahlen geöffnet. Schweden hatte im Mai die höchste Inzidenz in ganz Europa – gleichzeitig war die Todesrate eine der niedrigsten europaweit mit 12 Toten je 1 Millionen Einwohner (Woche 18 & 19).
Allerdings gelang es in Schweden nach den Erfahrungen der ersten Welle, die ältere Bevölkerung trotz der hohen Infektionszahlen in der zweiten und dritten Welle besser zu schützen. Wenn man die Daten zur Übersterblichkeit in der älteren Bevölkerung untersucht, sieht man deutlich, dass es in Schweden im Dezember und Januar keine höhere Sterblichkeit als in den Vorjahren gab – ganz im Gegensatz zu Deutschland (hier ein Vergleich der Übersterblichkeit von verschiedenen Ländern unter den Über-65-Jährigen und den Über-85-Jährigen, Quelle: Euromomo). Eine Untersuchungskommission zu den hohen Todeszahlen in Pflegeheimen im Dezember und Januar gab es in Deutschland allerdings bisher nicht.
Die Lockdown-Vertreter sehen das schwedische Modell hingegen als gescheitert an, da die Übersterblichkeit des gesamten Jahres 2020 in Schweden höher war als in den skandinavischen Nachbarländern. Dies lässt sich jedoch anhand der Bevölkerungszusammensetzung erklären: Schweden verfügt über deutlich mehr städtische Ballungsräume und hat einen höheren Anteil von Migranten. (Das soll hier nur am Rande erwähnt werden: Corona ist eine Krankheit, die überproportional oft ärmere Bevölkerungsschichten trifft. Dies liegt zum einen daran, dass diese Gruppen trotz Corona unter oftmals schlechten Arbeitsbedingungen (zum Beispiel in Schlachthöfen) weiterarbeiten müssen, und zum anderen daran, dass sich Infizierte aufgrund der Wohnverhältnisse nur schlecht isolieren können.) Wenn man die Übersterblichkeit in Bezug auf die mittleren Jahre 2015-2019 anschaut, dann hat Schweden im Corona-Jahr 2020 eine der niedrigsten Raten europaweit – deutlich niedriger als die südeuropäischen Länder mit ihren harten Lockdowns.
Die verschärfte Lockdown-Strategie
In Deutschland erkannten die Lockdown-Wissenschaftler bereits im Dezember, dass die Politik ihre Maßnahmen immer wieder verwässerte und diese in ihren Augen nicht konsequent genug umsetzte. Daher koordinierten sich die Wissenschaftler zunächst im Dezember und gaben eine Stellungnahme zu einem in ihren Augen notwendigen Shutdown heraus. Im Januar radikalisierten die Wissenschaftler ihre Strategie und forderten, dass die Politik eine No-Covid-Strategie verfolgen sollte, die einen Shutdown des kompletten öffentlichen Lebens vorsah bis die Infektionszahlen auf Null sinken. Ansonsten würden die von der Politik immer wieder verwässerten Maßnahmen zu immer neuen Lockdowns führen.
Dies bedeutete eine Verschärfung des bisherigen Ansatzes, der darauf ausgerichtet war, den exponentiellen Anstieg zu verhindern (flattening the curve), um so das Gesundheitssystem zu entlasten und durch Impfungen eine baldige Immunität der Bevölkerung zu erreichen. Der neue Ansatz zielte auf die Eliminierung des Virus und war inspiriert durch die radikalen Ansätze zur Bekämpfung von Corona in Neuseeland und China. Ob dieser Ansatz allerdings jenseits eines gut-isolierbaren Inselstaates wie Neuseeland und außerhalb eines autoritären Regimes wie China funktionieren konnte, war während der ersten Welle im Jahr 2020 noch umstritten. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Frühjahr 2021 blickten Wissenschaft und Medien jedoch hoffnungsvoll auf diese Länder und deren Strategien. Hinzu gekommen war insbesondere Australien, das die No-Covid-Strategie radikal umsetzte und Millionen-Städte wegen einzeln auftretender Fälle sperrte. Dass in Australien zu diesem Zeitpunkt Sommer war und sich Corona so besser kontrollieren ließ, wurde kaum berücksichtigt. Das Ergebnis stand im Vordergrund der Argumentation: Wie positiv wäre es für alle, wenn es keine Corona-Fälle mehr gäbe! Den Weg dahin sollte ein Shutdown-Zeitplan ebnen, der an der jeweiligen Inzidenz des Kreises orientiert war: Wie lange ein solcher Shutdown realistischerweise in einem deutschen Winter dauern würde, um eine Inzidenz von null zu erreichen, wurde jedoch nicht thematisiert (in Melbourne dauerte der rigorose Shutdown im Winter beispielsweise 15 Wochen). Ebensowenig wurde die grundsätzliche Frage gestellt, ob die geforderten Maßnahmen zur Eliminierung von Corona einer Demokratie angemessen sind oder eher zu einem Gesundheitspolizeistaat führen. Die No-Covid-Strategie befand sich zudem in einer Grauzone zwischen Politik und Wissenschaft: Handelte es sich um einen wissenschaftlichen Vorschlag zur Bekämpfung von Corona oder eher um eine politische Strategie, die von Wissenschaftlern vertreten wurde?
Die Politik übernahm die Interpretation der Wissenschaftler, dass die Lockdowns im November und Dezember nicht schnell und konsequent genug erfolgt seien. Angela Merkel räumte dies als Fehler in ihrer Regierungserklärung im Februar ein: „Wir [waren] nicht vorsichtig genug und nicht schnell genug. Wir haben auf die Anzeichen der zweiten Welle und die Warnungen verschiedener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hin nicht früh genug und nicht konsequent genug das öffentliche Leben wieder heruntergefahren.“ Dementsprechend wurde der seit Dezember bestehende Lockdown fortgesetzt und keine Lockerungen zugelassen. Im Februar wurde von der Ministerpräsidentenkonferenz sogar beschlossen, dass es Lockerungen erst unterhalb eines (im Winter recht utopischen) Wertes von 35 geben sollte. Dieser Wert war bereits im November ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen worden, ohne dass man davon allerdings Lockerungen abhängig gemacht hatte. In den Monaten Februar und März war die Politik somit stark vom Eindruck der zweiten Welle und den an einer No-Covid-Strategie angelehnten Forderungen der Lockdown-Wissenschaftler geprägt – ohne allerdings deren radikale Ideen von roten und grünen Zonen zu übernehmen.
Die Medien berichteten in den Monaten Dezember und Januar täglich über die neuen Todeszahlen – ohne diese allerdings einzuordnen, indem beispielsweise angegeben wird, wieviele Menschen täglich in Deutschland auch ohne Corona sterben. Schon damals gab es auch Kritik an den Zahlen, da sich das Robert-Koch-Institut bei der Berechnung nicht an den internationalen Standards orientierte und zudem vielen Gesundheitsämtern die Logik der Aufschlüsselung unklar war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren die berichteten Zahlen durch diese beiden Faktoren zu hoch.
Um ihr kritisches Potential zu schärfen, fanden die Medien in dieser Zeit aber auch ein neues Thema: Das „Impfdesaster“ in der europäischen Union und später in Deutschland. Hier konnte das in den Medien gern verwendete Narrativ, dass Deutschland ein abgehängtes und rückständiges Land sei, bedient werden, das in den letzten Jahren gerne im Zusammenhang mit der Digitalisierung verwendet wurde. Dass die Impfung von vielen Millionen Menschen nicht in einem Monat umsetzbar war und eine koordinative Leistung ist, hätte eigentlich auch den Medien bewusst sein können.
Die Dramatik und Aufgeregtheit der Berichterstattung erklärte sich aber auch durch die Bedeutung der Impfung: Sie stellte den alleinigen Ausweg aus der Corona-Krise und den Lockdowns dar. Die Verantwortung, die Politik, Medien und Wissenschaft in ihrer Argumentation für jeden einzelnen Todes- und Long-Covid-Fall übernommen haben, lasse sich nur durch die Impfung beenden. Die Logik war: Die Pandemie endet erst dann, wenn ein bestimmter hoher Prozentsatz der Bevölkerung geimpft ist. Dies ist plausibel, wenn man wie die Lockdown-Wissenschaftler die Idee ablehnt, dass es bestimmte abgrenzbare Risikogruppen gibt, die durch eine Corona-Infektion gefährdeter sind, und annimmt, dass gar nicht feststellbar ist, wer zur Risikogruppe gehört. In dieser Logik kann die Allgemeinbevölkerung, bei der unklar ist, ob sie einem höheren Sterbe- oder Long-Covid-Risiko ausgesetzt ist, nur durch eine Impfung geschützt werden. Eine Differenzierung des Risikos darf nicht vorgenommen werden – die Festlegung einer Impfreihenfolge nach Risikogruppen stellte lediglich eine kurzzeitige Ausnahme von dieser Möglichst-Alle-Müssen-Geimpft-Werden-Strategie dar. Die Vorstellung, dass die Pandemie für die Bevölkerung nicht mehr gefährlich ist, wenn die Risikogruppen und alle, die es wollen, geimpft sind, wird abgelehnt. Dies würde eine unkontrollierte Verbreitung von Corona bedeuten, die man auf jeden Fall vermeiden will. In der Bedeutung der Impfung für die Bekämpfung von Corona spiegelt sich die anfangs beschriebene wissenschaftliche Kontroverse wider.
Eine Begründung für das weiter bestehende Gefahrenpotential, bot insbesondere auch die britische Virusmutation. Über diese Mutation war lediglich bekannt, dass sie deutlich ansteckender als das bisherige Corona-Virus war und sich auch in Deutschland verbreitete. Über eine höhere Tödlichkeit konnte zunächst nur spekuliert werden – die Gefahr bestand allerdings darin, dass eine höhere Ansteckungsrate auch zu einer größeren Anzahl an Hospitalisierungen und schweren Verläufen führte.
Für die Wissenschaft war diese Mutation daher Anlass, ihre Forderungen nach einem härteren Shutdown zu erneuern und Lockerungen auszuschließen. Einige Wissenschaftler bezweifelten aufgrund dieser Mutante sogar, dass die Infektionszahlen im Sommer sinken könnten. Die Medien konnten mit Hilfe der Mutation wieder dramatischer über die Ausbreitung dieser Variante berichten und die Bürger zur weiteren Befolgung der Corona-Maßnahmen anhalten – insbesondere in den Monaten Februar und März, in denen die Infektionszahlen sanken. Die Politik konnte mit dem Hinweis auf „die neue Pandemie“ (Angela Merkel) die weiterhin harten Maßnahmen rechtfertigen, die sie aufgrund der Beratung durch die Wissenschaft für berechtigt hielt.
Die dritte Welle
Der Beginn der dritten Welle Anfang April wurde ebenfalls durch die britische Virusmutation erklärt. Dass diese Variante einen Anteil an den steigenden Infektionszahlen hatte, ist wahrscheinlich. Die dritte Welle breitete sich jedoch – anders als die erste und die zweite Welle – nicht bundesweit gleichmäßig aus. Die dritte Welle wurde ausgelöst durch hohe Infektionszahlen in Tschechien und verbreitete sich von Thüringen, Sachsen und Bayern in weitere Teile Deutschlands (vgl. Karte). Im Westen gab es zudem einige Corona-Hotspots, die wahrscheinlich durch Infektionen in der Fleischindustrie ausgelöst worden waren. Ein weiterer Auslöser war, dass die Infektionszahlen – insbesondere unter den 5-14-Jährigen – durch das vermehrte Testen in Schulsettings stark anstiegen.
Wie auch schon während der vorherigen Wellen, durfte jedoch nicht zwischen den Infektionen unterschieden werden: Dass die Zahlen nur durch die vermehrten Infektionen der unter 60-Jährigen anstiegen (vgl. hier, Abb. 7), war nicht von Bedeutung. Auch nicht, dass die Risikogruppen dank der Impfung gar nicht mehr gefährdet waren – Über-80-Jährige infizierten sich immer weniger und die Todeszahlen stiegen seit Januar nicht mehr (vgl. beispielsweise hier, Abb. 8 und Abb. 9). Stattdessen wurden in den Medien dramatische Szenarien skizziert – Virologen sagten voraus, dass Ende April Triage in deutschen Krankenhäusern gemacht werden müsse. Zudem wurde wieder mehr über Long Covid geschrieben und von Intensivstationen berichtet, die mit immer jüngeren Patienten bald voll seien.
Die Häufigkeit von Long Covid konnte immerhin langsam besser eingeschätzt werden: Im April 2021 schätzte die britische Statistikbehörde, dass etwa 14 Prozent der Infizierten auch drei Monate nach der Infektion noch Long-Covid-Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerz oder Husten haben. Diese dramatischen und relativ häufigen Schicksale wurden allerdings in den Medien nicht ergänzt um eine ähnliche Anzahl an persönlichen Porträts von Personen, die im Lockdown psychische Probleme entwickelten.
Die Intensivstationen, die sich mit immer jüngeren Patienten füllen würden, waren allerdings ein medialer Mythos – dabei handelte es sich nur um vereinzelte Fälle. In Deutschland wurde erstaunlicherweise das Alter der Intensivpatienten bis Ende April nicht erhoben – vermutlich auch, um die Krankheit nicht als eine Krankheit der Alten erscheinen zu lassen und damit die Solidarität in der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Es gab aber auch Daten aus anderen Ländern, die das Alter schon lange erhoben: In Österreich war die Hälfte der Intensivpatienten über 65 Jahre alt (vgl. hier). Wenn ein großer Teil der bisher auf Intensivstationen behandelten Patienten nicht mehr dorthin kommt, ist eine Überlastung der Intensivstationen zunehmend unwahrscheinlicher. Aber auch an den in Deutschland bereits erhobenen Zahlen konnte man schon im März erkennen, dass die Rate der Hospitalisierungen in allen Altersgruppen seit Februar abnahm (vgl. hier, Abb. 5 und 6). Man muss hier aber auch ergänzen, dass die Einschätzung der Entwicklung der aktuellen Zahlen durch die Politik insbesondere durch die Vorläufigkeit der Daten (Nachmeldungen) auch erschwert wurde – insbesondere, wenn es in den Medien zeitgleich Modelle gab, die dramatische Szenarien vorhersagten.
Allerdings hätte man zur Einordnung der Zahlen und Entwicklungen auch die europäischen Zahlen zum Vergleich heranziehen können: Die deutschen Infektionszahlen waren seit Februar durchgehend niedriger als in den meisten anderen europäischen Ländern. Gleichzeitig gilt das deutsche Gesundheitssystem weltweit als eines der bestausgestatteten und auch die Versorgung mit Krankenhausbetten ist im europäischen Vergleich sehr hoch. Wenn also in Deutschland bei einem (im europäischen Vergleich sehr niedrigen) Inzidenzwert von 100 in Kürze die Anwendung von Triage droht, wie soll die Situation dann in Portugal oder Tschechien oder Großbritannien bei einem länger andauernden Inzidenzwert von über 700 sein?
Die Berichterstattung der Medien orientierte sich, wie oben beschrieben, an Negativität und katastrophischen Superlativen. Dies passte sehr gut zu der haltungsjournalistischen Aufgabe, die die Medien für sich selbst – in Übereinstimmung mit den von ihnen zitierten Wissenschaftlern – festgelegt hatten: Die Bevölkerung von der Wichtigkeit der Regeleinhaltung zu überzeugen und damit eine katastrophale Situation in den Krankenhäusern zu verhindern. Auf diese Weise fand möglicherweise auch ein Wettrüsten statt: Wenn die Bürger die Corona-Regeln nicht mehr befolgen und corona-müde werden, dann müssen sie durch immer dramatischere Szenarien wieder zur Befolgung angehalten werden. Dass die alarmistischen Modelle nicht eingetreten sind, erklären die Wissenschaftler mit dem sogenannten Präventionsparadoxon: Weil man gewarnt habe, seien die Zahlen heruntergegangen, daher wirke die Warnung im Nachhinein übertrieben. Allerdings besteht bei wissenschaftlichen Katastrophenszenarien und extrem alarmistischer Berichterstattung immer auch die Gefahr, dass man durch zu viele Fehlalarme Vertrauen verspielt und beim nächsten (möglicherweise echten) Alarm niemand mehr darauf reagiert.
Auch in der dritten Welle musste die Politik erneut ihre Handlungsfähigkeit beweisen. Ostern drohte zu einem Superspreading-Event zu werden. In einer Marathonsitzung der Regierung mit den Ministerpräsidenten beschloss man, dass es eine sogenannte „Osterruhe“ geben sollte. Diese Idee war juristisch so kurzfristig nicht umsetzbar und musste von der Kanzlern als Fehler eingestanden und dann wieder zurückgenommen werden. Die nicht umgesetzte Osterruhe führte aber dazu, dass Entscheidungen über Maßnahmen nicht mehr gemeinsam mit den Ländern getroffen werden sollten, sondern dass die Regierung das Infektionsschutzgesetz änderte. Maßnahmen sollten dank der „Bundesnotbremse“ ab bestimmten Inzidenzwerten automatisch in Kraft treten. Damit beendete die Regierung auch das oben beschriebene föderale Wirrwarr an Maßnahmen. Das Gesetz war einmalig in seiner juristischen Konstruktion. Die Länder stimmten im Bundesrat erstaunlicherweise ihrer eigenen Entmachtung zu.
Als diese Regelung beschlossen wurde, war der Höhepunkt der dritten Welle bereits überschritten. Seit Ende April sanken die Infektionszahlen deutlich. Warum die Zahlen so stetig sinken, ist unklar – möglicherweise greifen die Impfungen, möglicherweise treffen sich die Menschen auch mehr im Freien, möglicherweise hemmen die leicht höheren Temperaturen die Ausbreitung des Virus. Dass allerdings die Bundesnotbremse diesen Effekt ausgelöst haben könnte und sich mehr Menschen an deren eindeutige Regelungen halten, ist unwahrscheinlich – die Zahlen sanken zum einen auch schon vor dieser Regelung und zum anderen ist die Motivation der Bevölkerung sich an diese neuen Corona-Regeln zu halten, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr sehr hoch.
„Sonderrechte“ und Schnelltests
Anfang Mai führte die Politik mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit „Sonderrechte“ für Geimpfte und Genesene ein – zunächst allerdings nur in einem kleineren Umfang. Dies war Ende des letzten Jahres noch vehement verneint worden. Anfang Februar hatte der Ethikrat erklärt, dass es „Sonderrechte“ für Geimpfte und Genesene nur geben könne, wenn nachgewiesen sei, dass diese nicht mehr ansteckend seien. Dies konnte bisher wissenschaftlich zwar nicht nachgewiesen werden – Einigkeit besteht allerdings darin, dass es ein deutlich geringeres Risiko gibt. Der Begriff „Sonderrechte“ stellt allerdings schon eine Umkehrung der Logik des Grundgesetzes dar: Die Gewährung von Grundrechten darf nicht vom Gesundheitszustand, also vom Impfstatus, eines Menschen abhängig gemacht werden, sondern der Staat muss begründen, wenn er diese Grundrechte seinen Bürgern vorenthält. Ein weiteres rechtlich umstrittenes Vorhaben wird in Kürze folgen: Ein digitaler Impfpass soll auf europäischer Ebene den Tourismus wieder möglich machen. Dass es noch Kritik an der Einführung dieses Impfpasses geben wird, ist unwahrscheinlich. Die mediale Berichterstattung über alle Themen, die im Zusammenhang mit den Impfungen stehen, erscheint extrem einseitig – ganz im Sinne der oben beschriebenen Logik, dass die Pandemie erst endet, wenn alle geimpft wurden. Dies schließt auch die Kinder ein, für die Corona nachgewiesenermaßen keinerlei Gefahr darstellt – ganz im Gegensatz zu einem nicht ausreichend erprobten Impfstoff.
Die Einführung der „Sonderrechte“ war auch ermöglicht worden durch die Nutzung von Schnelltests. Im März wurde die Corona-Test-Verordnung so geändert, dass Schnelltests nicht mehr nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden können: Eine einstündige Schulung reicht, um als „geschultes Personal“ die Tests durchführen zu können. Dementsprechend schnell entstanden auch viele Testzentren. Mit Hilfe der Schnelltests konnten die Nicht-Geimpften dieselben „Sonderrechte“ erhalten – man konnte ihnen also eine Handlungsoption bieten, auch wenn sie noch keine Impfung erhalten hatten.
An den Schnelltests erkennt man auch ein letztes wichtiges Prinzip der Bekämpfung von Corona: Maßnahmen, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nur teilweise erwiesen ist (Alltagsnutzung von Masken), und Maßnahmen, die aus wissenschaftlicher Sicht auch mit deutlichen Nachteilen behaftet sind und daher von der Wissenschaft skeptisch betrachtet werden (Schnelltests), werden von der Politik massenhaft umgesetzt, wenn dies in die politische Strategie passt. Dies war weiter oben bereits für die eher symbolpolitischen Kleinmaßnahmen rund um die Idee der maximalen Kontaktvermeidung beschrieben worden. Dies wird von der Politik aber auch für eine Entwicklung in die andere Richtung genutzt – wenn es um Öffnungen geht. Die Masken ermöglichten der Politik eine gesichtswahrende Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens im Sommer 2020 und die Schnelltests leisten dies – in Kombination mit den Impfungen – im Sommer 2021.
Wie wird es weitergehen? Es kann sein, dass die Politik am Impfpass und den Schnelltests festhält. Die Einführung der minimalen „Sonderrechte“ war dann nur der Anfang und weitere „Lockerungen“ nach diesem Prinzip werden folgen. Es kann aber auch sein, dass die Politik sich vom Konzept des permanenten Nachweisens der eigenen Corona-Ungefährlichkeit verabschiedet, wenn die Zahlen weiterhin sinken. Durch das Sinken der Zahlen, ändert sich auch die Logik der Politik – insbesondere da im September eine Bundestagswahl ansteht. Im Frühjahr 2021 galt unter dem Eindruck des Winters noch: Wer mit seiner Politik eine Überlastung der Intensivstationen herbeiführt, dezimiert seine Chancen bei den Wählern. Im Mai gilt unter dem Eindruck des kommenden Sommers aber: Wer Maßnahmen lockert, der gewinnt die Zustimmung der Bevölkerung zurück. Ob allerdings damit die durch den Lockdown und die Polarisierung entstandenen Wunden auch heilen können, ist offen und wird sich wohl erst in den kommenden Jahren zeigen.
Zusammenfassung
Corona wurde zunächst von der Politik und den Medien als Grippe verstanden. Die mediale Katastrophen-Berichterstattung aus Norditalien änderte dies grundlegend – auch wenn viele andere Faktoren für die dortige Entwicklung verantwortlich waren. Der Schutz der Bevölkerung vor Corona und die Verhinderung einer Überlastung der Krankenhäuser wurde zu einer Aufgabe der Politik. Der erste Lockdown und der einsetzende Sommer senkten die Zahlen und führten in Politik und Medien zu dem Glauben, dass keine zweite Welle kommen würde.
In der Wissenschaft setzte sich das Paradigma durch, dass Corona nur durch konsequente Lockdowns bekämpft werden könne – der Schutz der Risikogruppen ließe sich nur so gewährleisten. Alle anderen Ansätze, die stärker auf den Schutz der Risikogruppen und differenziertere Lockdowns setzen wollten, wurden radikal bekämpft.
Als die zweite Welle in Deutschland im November einsetzte, hatten die radikalen Lockdown-Befürworter die Deutungshoheit in Politik und Medien übernommen. Die von diesen Wissenschaftlern vertretene Idee der maximalen Kontaktvermeidung machte eine Differenzierung der Maßnahmen nicht mehr möglich. Lediglich die Wirtschaft wurde von der Politik – entgegen der Empfehlung der Wissenschaftler – geschont. Die durch die Medien zum allgemeinen Indikator erhobenen Inzidenzwerte führten bei Politikern auf allen föderalen Ebenen dazu, dass sie bei zu hohen Infektionszahlen ihre Handlungsfähigkeit durch immer kreativere Maßnahmen beweisen mussten.
Die Medien stellten dieses Maßnahmen-Durcheinander nur punktuell in Frage. Sie sahen es vielmehr als ihre Aufgabe an, die Menschen von den „alternativlosen“ Maßnahmen der Politik zu überzeugen. Alle Äußerungen, die die verfolgte Lockdown-Politik grundlegend in Frage stellten, wurden skandalisiert und als Weg in eine humanitäre Katastrophe dargestellt. Auf diese Weise gelang es den Medien nicht mehr, alle gesellschaftlich relevanten Positionen im öffentlichen Raum widerzuspiegeln. Polarisierte Diskussionen in den sozialen Medien und Stellvertreterkriege im privaten Raum waren die Folge.
Von dieser Polarisierung profitieren insbesondere die Rechten, die in den nächsten Wahlen viele von der Politik Enttäuschte gewinnen werden. Die Linken spalten sich dagegen in zwei Gruppen: Der einen Gruppe gehen die Lockdown-Maßnahmen der Politik nicht weit genug, während die andere Gruppe aus Impfskeptikern und Linksliberalen besteht, die den Maßnahmen sehr skeptisch gegenüber stehen. Die zweite Gruppe verdeutlichte ihre Kritik auch auf Demonstrationen der Querdenken-Bewegung – gemeinsam mit bürgerlichen Liberalen und einigen rechten Verschwörungstheoretikern.
Die Bilanz der deutschen Lockdown-Strategie im Winter ist hingegen dramatisch: Während die Zahlen unter der jüngeren Bevölkerung durch die beiden Lockdowns stagnierten oder leicht sanken, stiegen die Zahlen in der Risikogruppe der Über-80-Jährigen extrem an und führten zu vielen Toten. Insbesondere die Altenheime konnten nicht geschützt werden. Dies lag zum einen daran, dass im Sommer keine Strategie zum Schutz dieser bekannten Risikogruppe entwickelt worden war und zum anderen daran, dass, als der Regierung die Dramatik der Situation bewusst wurde, in einer wochenlangen bürokratischen Odyssee kein Personal zur Durchführung der Tests gefunden wurde. Alternative Ansätze wie in Tübingen, die auf einen stärkeren Schutz der Risikogruppen gerichtet waren, wurden nicht nach wissenschaftlichen Standards durchgeführt. Dies lag allerdings auch daran, dass wissenschaftliche Förderung nur an Projekte ging, die untersuchten, wie die Ideen der Lockdown-Befürworter am besten umgesetzt werden können.
Das einzige Land, das dem Lockdown-Paradigma mit einem Empowerment-Ansatz widersprach, war Schweden. Allerdings konnte auch dort die ältere Bevölkerung, die in Pflegeheimen lebte, während der ersten Corona-Welle nicht geschützt werden. Dies lag aber besonders auch an der kaum verfügbaren Schutzausrüstung und den Arbeitsbedingungen in den Pflegeheimen. In der zweiten Welle gelang der Schutz der älteren Bevölkerung besser – so dass die Übersterblichkeit in Schweden im Jahr 2020 eine der niedrigsten in Europa war.
In Deutschland erkannten die Lockdown-Wissenschaftler, dass die Politik ihre Maßnahmen immer wieder verwässerte und nicht konsequent genug umsetzte. Daher radikalisierten sie im Dezember und Januar ihre Strategie zur Bekämpfung von Corona zu einer No-Covid-Strategie, die auf die Eliminierung des Virus ausgerichtet war und sich an Australien orientierte. Die Politik übernahm diese Interpretation und verfolgte im Frühjahr 2021 eine Strategie, die sich an der No-Covid-Strategie orientierte – allerdings weiterhin ohne die Wirtschaft bei den Maßnahmen einzuschließen. Diese Fokussierung verhinderte im Folgenden auch, dass in der Politik, den Medien und der Wissenschaft wahrgenommen wurde, dass die Bedrohungslage für die Risikogruppen infolge der Impfungen sehr viel geringer wurde und die Gefahr einer Überlastung der Intensivstationen – trotz steigender Infektionszahlen – nicht mehr bestand. Stattdessen wurde in den Medien über Long-Covid-Fälle, immer jüngere Intensivpatienten und die extremen Wirkungen der neuen britischen Mutation berichtet und damit weiterhin Angst geschürt. Die Welle ebbte allerdings – entgegen der Vorhersagen der Modellierer – bereits Ende April ab.
Um Lockerungen zu ermöglichen, beschloss die Bundesregierung im Eilverfahren, dass Geimpfte und Genesene in kleinerem Umfang mehr Rechte erhalten. Dies war auch durch die Einführung der Schnelltests möglich geworden, da sie den Nicht-Geimpften die Option auf dieselben „Sonderrechte“ geben können. Ob dieser Weg der „Sonderrechte“ weitergeführt wird oder die Politik bei weiter sinkenden Zahlen generelle Lockerungen umsetzen wird, ist unklar. Das weitere Sinken der Zahlen könnte in Kürze – insbesondere in Anbetracht der Bundestagswahl im September – dazu führen, dass immer mehr Politiker für Öffnungen plädieren werden, um so das verlorengegangene Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewinnen.
(Picture: By Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library (PHIL), with identification number #23312)

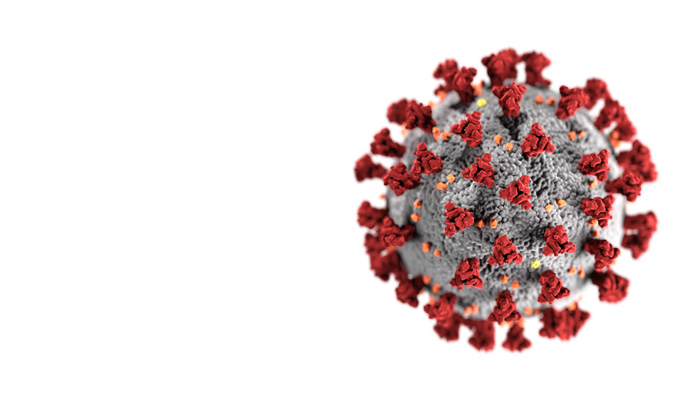
Hinterlasse einen Kommentar